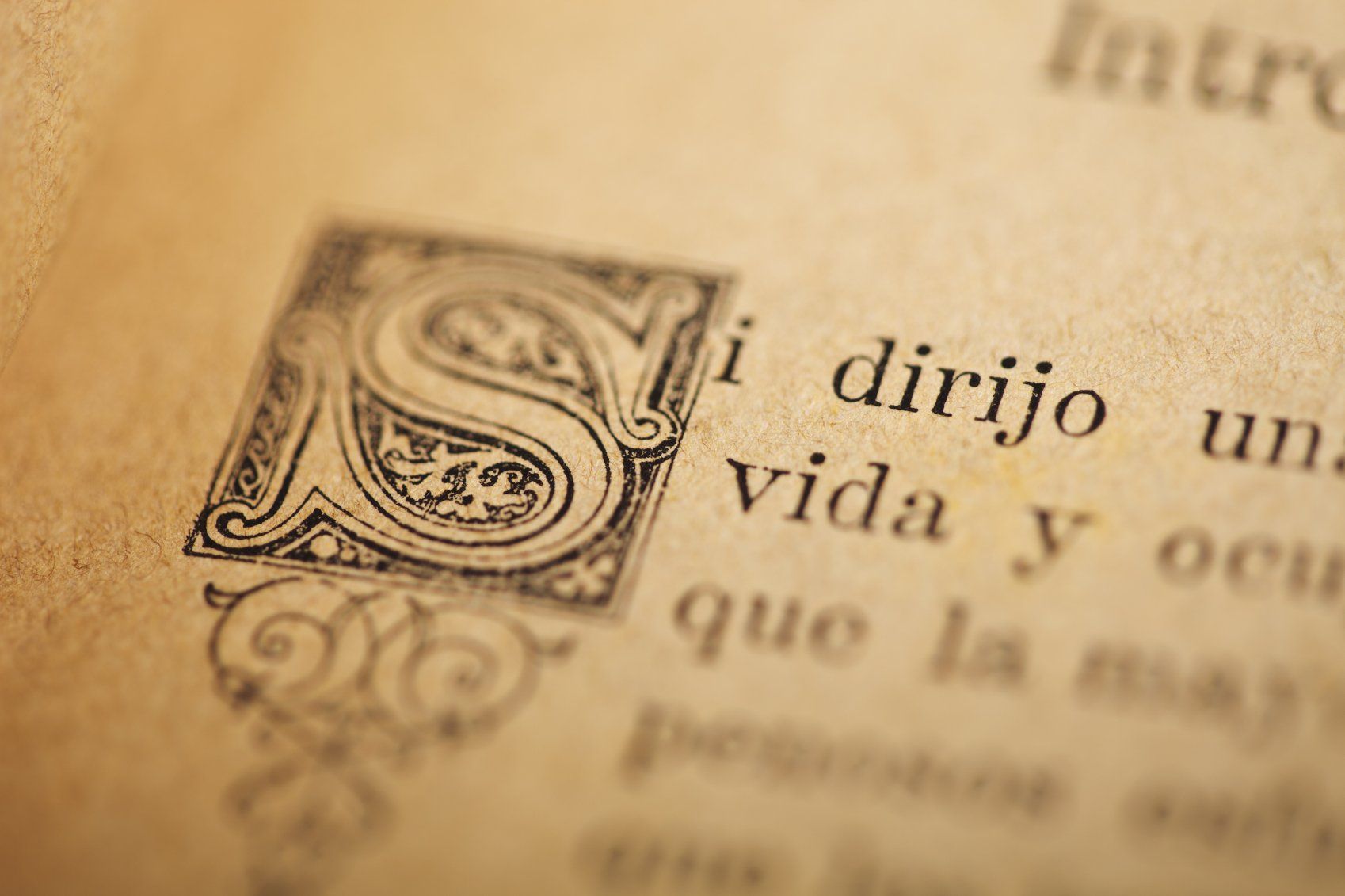Aderlass
Bei allen alten Völkern und den meisten Naturvölkern gehörte die Blutentziehung zu den allerersten therapeutischen Eingriffen. Besonders die alte indische Medizin kannte zahlreiche Indikationen für den Aderlass.
Aderlass, auch als Blutletting bekannt, ist eine der ältesten medizinischen Praktiken der Menschheit. Diese Methode, bei der Blut aus dem Körper entfernt wird, um gesundheitliche Probleme zu behandeln, war jahrhundertelang weit verbreitet. Heute ist Aderlass in der modernen Medizin nicht mehr üblich, aber die Geschichte dieser Praxis bietet spannende Einblicke in die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft. In diesem Artikel erfahren Sie, was Aderlass ist, wie er durchgeführt wurde und warum er schließlich aus der modernen Medizin verschwand.

Im Laufe der abendländischen Medizingeschichte geriet der Aderlass allerdings in Verruf, da er - mit den entsprechenden medizinischen Folgen - über lange Zeit als Allheilmittel überschätzt und übertrieben eingesetzt wurde. Erst langsam gewinnt der Aderlass als Heilverfahren seine Anerkennung zurück. Inzwischen wird er auch in schulmedizinischen Krankenhäusern wieder als Therapieform eingesetzt.
Die Ursprünge des Aderlasses
Der Aderlass hat seine Wurzeln in der Antike, insbesondere in der griechischen Medizin. Bereits Hippokrates, der als Vater der westlichen Medizin gilt, glaubte, dass das Gleichgewicht der Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) entscheidend für die Gesundheit sei. Der Aderlass wurde angewendet, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, indem überschüssiges Blut aus dem Körper entfernt wurde. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war Aderlass eine gängige Methode, um eine Vielzahl von Erkrankungen zu behandeln, darunter Fieber, Kopfschmerzen und Infektionen.
Von einigen Ärzten wurde er als eines der wichtigsten therapeutischen Verfahren gepriesen, von anderen als nutzlos und gefährlich verdammt. In der Tradition der Befürworter stehen Hippokrates (um 460 v. Chr.), der ihn bei Entzündungen und Schmerzzuständen empfiehlt, und Galen (2. Jh. n. Chr.). Paracelsus spricht sich im 16. Jahrhundert gegen unmäßige Aderlässe aus. Dennoch führt der italienische
Anatom Botalli im 16. Jahrhundert einen regelrechten, Vampirismus ein: »Je mehr unreines Wasser man aus einem Brunnen zieht, umso mehr reines strömt hinzu.« In Deutschland weist Hildegard von Bingen (→ Hildegard-Medizin) auf die große therapeutische Bedeutung des Aderlasses hin.
All diese bekannten Befürworter konnten jedoch nicht verhindern, dass der Aderlass im 19. Jahrhundert aus der Medizin verschwand.
Wiederaufleben eines alten Verfahrens
Auch heute noch gehört der Aderlass zu den vernachlässigten, ja fast vergessenen Methoden - selbst bei der auf die Zusammensetzung und die Bestandteile der Humore (= Körpersäfte) orientierten Naturheilkunde. Um seinen Wert zu er-halten, gilt es, die Erfahrungen der medizinischen Vergangenheit mit neueren Möglichkeiten und Erkenntnissen zu vergleichen. Nur so kann die Fülle und der reichhaltige Schatz empirischen Wissens erhalten bleiben und die Verarmung therapeutischer Hilfsmittel verhindert werden.
Der Aderlass bewirkt zum einen eine Verringerung, Entlastung und Reinigung des Blutes, zum anderen wird die Blutbildung angeregt, selbst bei blutarmen Menschen. Dieses aktiviert das Immunsystem. Er greift - wie alle Ausleitungsverfahren - tief in das vegetativ-hormonale Geschehen des Organismus ein und kann als konstitutionsstabilisierende und -verbessernde Therapie angesehen werden. Er wirkt krampflösend und schmerzstillend.
Ausführung
Früher, als die Dynamik des Körpers stärkere Beachtung fand, waren viele Stellen bekannt, an denen der Aderlass ausgeführt wurde, je nach Tages- und Jahreszeit, körperlicher Verfassung, Alter und Geschlecht. Heute geschieht dies jedoch fast nur noch an der Vene in der Ellenbeuge. Die Menge (zwischen 50 und 500 ml) richtet sich nach Alter, Geschlecht und Konstitution des Menschen.
Indikationen und Kontraindikationen
Das große Indikationsgebiet des Aderlasses ist die Blutfülle und die Blutstauung. Dazu gehören folgende Krankheitsbilder:
- Kopfschmerzen, Schwindel, Schweißausbrüche, Ohrensausen, Nasenbluten, Schlaflosigkeit
- Neigung zu Entzündungen innerer Organe
- Asthma
- Krampfadern, Hämorrhoiden
- Depressionen und andere seelische Verstimmungen
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die so genannte
Vergiftung des Blutes und der Körpersäfte
Sie tritt auf bei:
- jeder akuten Entzündung, auch bei infektiösen Kinderkrankheiten (kleiner Aderlass bei Fieber),
- chronischen Hauterkrankungen und
- Rheuma.
Der Aderlass ist darüber hinaus ein einfaches Mittel zur Regulierung der Körpersäfte bei:
- Übersäuerung des Organismus,
- Verstopfung,
- Reinigungskuren, besonders im Frühling
- Warnhinweise
Aderlass darf nur von einem spezialisierten Heilkundigen durchgeführt werden.
Vorsicht ist geboten bei Herz- und Kreislauf-erkrankungen, bei Körperschwäche, hochgradiger Nervosität, Menschen über 65 Jahren, Kindern und Jugendlichen.
Aderlass ist nicht mit einer einfachen Blutentnahme zu vergleichen. Deshalb sollten bei gehäufter Anwendung dieses Verfahrens Blutbildkontrollen durchgeführt werden.
Weiterführende Themengebiete
- Was ist Naturheilkunde?
- Übersicht Naturheilverfahren
- Aura soma
- Akupunktur
- Anthrosophische Medizin
- Aromatherapie / Ätherische Öle
- Ausleitungsverfahren
- Balneotherapie
- Bach - Blüten
- Die 38 Bach Blüten
- Bindegewebsmassage
- Blutegeltherapie
- Edelsteintherapie
- Eigenbluttherapie
- Heilsteine, Edelsteine & Kristalle
- Eigenbluttherapie
- Enzymtherapie
- Homöopathie
- Homöopathie Tiere
- Kneipp - Therapie
- Hydrotherapie
- Hypnose
- Phytotherapie
- Spagyrik
- Vorbeugen ist besser als heilen!