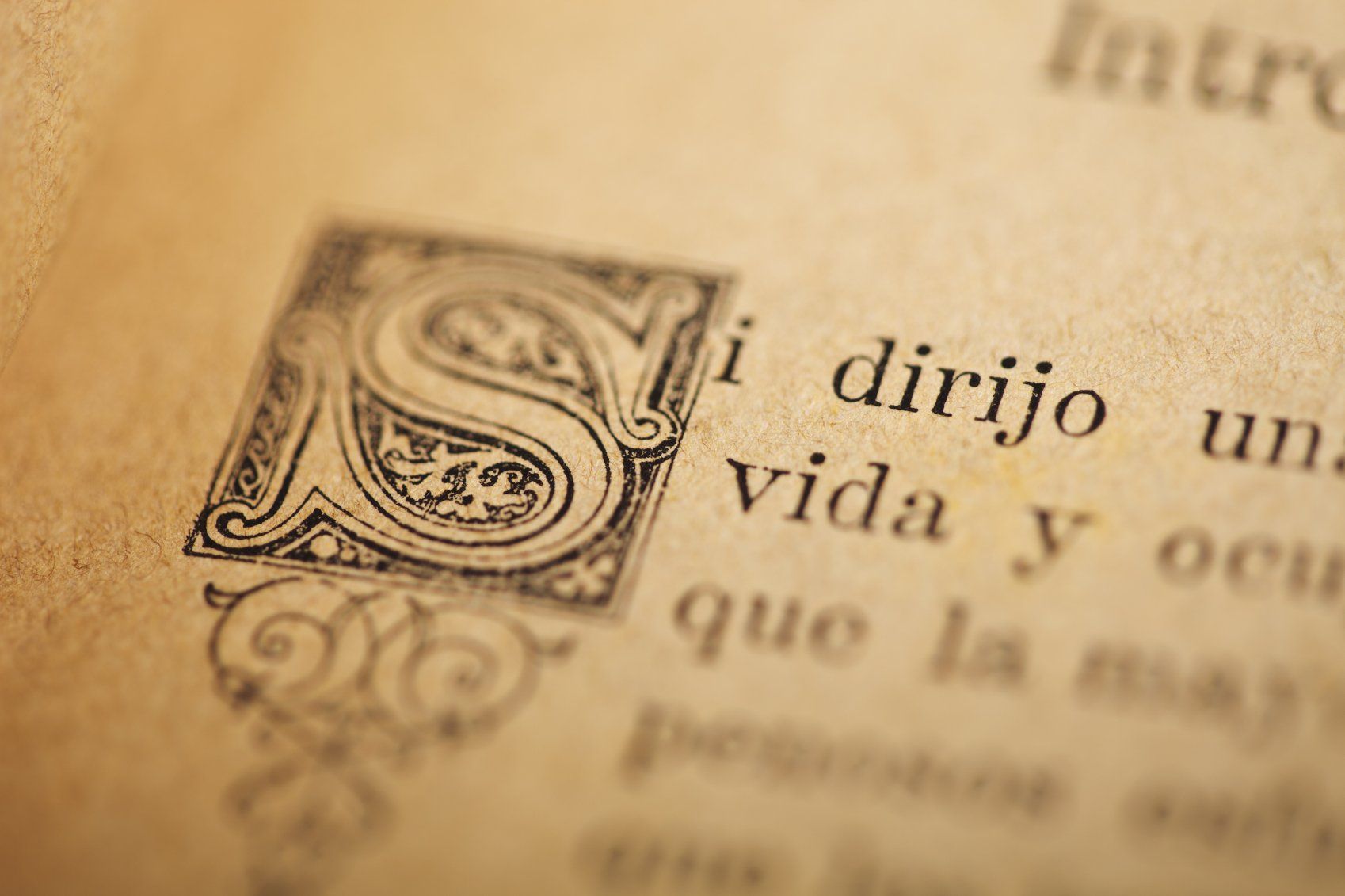Kneipp - Therapie
Pfarrer Kneipp verbinden die meisten Menschen mit offenen Sandalen und Wassertretbecken in öffentlichen Parkanlagen. Doch dass die Kneipptherapie ein wohl durchdachtes, ganzheitliches System zur Behandlung des Menschen ist, dessen Wirksamkeit mittlerweile auch naturwissenschaftlich belegt und schulmedizinisch anerkannt ist, ist den Wenigsten bekannt. Die Kneippsche Behandlung beruht auf fünf Grundelementen, die je nach Art der Krankheit allein oder kombiniert angewandt werden, und macht sich sämtliche Naturfaktoren wie Wärme und Kälte, Wasser, Erde, Luft und Licht, Heilpflanzen sowie das soziale Umfeld zu Nutze.

Sebastian Kneipp
S. Kneipp, versuchte dem Menschen deutlich zu machen, dass die Gesundheit als sein höchstes Gut erhalten werden müsse. Er selbst hatte als junger Mann die schmerzliche Erfahrung schwerer Krankheit gemacht und versuchte daher in späteren Jahren, andere davor zu bewahren. Kneipp wurde 1821 in Stephansried in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Bereits als Elfjähriger musste er mit für den Lebensunterhalt der Familie sorgen und sein Wunsch, Priester zu werden, konnte nur durch finanzielle Förderung eines entfernten Verwandten erfüllt werden. Während der Schulzeit an Tuberkulose erkrankt und von der damaligen Medizin schon aufgegeben, fiel dem jungen Theologiestudenten schließlich eine Abhandlung des Arztes Siegmund Hahn über die Heilkraft des Wassers in die Hände. In dem Bewusstsein, dass er nichts weiter zu verlieren habe, ließ sich Kneipp auf die darin beschriebenen Anwendungen ein. Heimliche Bäder in der Donau und eiskalte Gießkannen Güsse mit Brunnenwasser, die Kneipp ständig weiterentwickelte, stellten die ersten Kneipp Anwendungen dar und ließen Sebastian Kneipp nach zweijähriger Kur vollkommen gesunden. So konnte er seine Primiz 1852 mit 31 Jahren in Ottobeuren feiern. Nach verschiedenen anderen Stationen kam er 1855 nach Bad Wörishofen, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1897 wirken sollte.
Neben täglicher bäuerlicher Arbeit und seiner Tätigkeit als Geistlicher begeisterte Kneipp sich zusehends dafür, Kranken zu helfen und gesunde Menschen vor Krankheiten zu schützen. Außer der stetigen Verbesserung seiner Wasseranwendungen und der Errichtung des ersten Kneippschen Badehäuschens erforschte Kneipp die heilende Wirkung von Pflanzen sowie den positiven Einfluss gesunder Ernährung und Bewegung auf den menschlichen Organismus. Seine Behandlungsmethoden wurden schnell populär. Kneipp hielt Vorträge in ganz Europa, schrieb verschiedene Abhandlungen und scharte in Bad Wörishofen, wo er mittlerweile Stadtpfarrer geworden war, einen stetig wachsenden Kreis von Ärzten und Bademeistern um sich. Drei Jahre vor seinem Tod wurde Kneipp auf einer Romreise durch Papst Leo XIII. der Titel Monsignore verliehen. Am 17. Juni 1897 starb Sebastian Kneipp mit 76 Jahren in Bad Wörishofen. Seine einzigartige Naturheilmethode war zu diesem Zeitpunkt schon zur Volksbewegung geworden. Noch in seinem Todesjahr wurde der deutsche Kneipp Bund gegründet.
_________________________
Das Kneippsche System ist nicht nur ein Heil-, sondern auch ein Lebenskonzept, das auf fünf Grundelementen, den fünf Säulen, beruht.
- Wasseranwendungen
- Heilkräuter
- Bewegung
- ausgewogene Ernährung
- Lebensordnung
Ihre Anwendung zielt auf den harmonischen Ablauf der Funktionen des menschlichen Körpers und der Psyche ab. Vor allem die Kombination aller Elemente führt zu einer deutlichen Stärkung der Gesundheit.
In der ursprünglichen Kneipptherapie stellten die Wasseranwendungen das Herzstück dar. Heilpflanzen popularisierte Kneipp erst nach und nach, sie kamen durch seine Empfehlungen zum Einsatz. Das wechselwarme Kräuterbad, Wickel mit Kräutern, Quark oder Lehm, das Tau- und Schneelaufen mit nackten Füßen und das Wassertreten wurden bei den Kneippschen Therapien angewandt; Güsse sowie Halb- und Vollbäder waren jedoch Kneipps Spezialität.
Die moderne Kneipptherapie legt gesteigerten Wert auf eine Verknüpfung der fünf Säulen.
_______________________
Wasseranwendungen
Die Wasserbehandlung nach Kneipp besteht in einem aktiven Training der Blutgefäße und des gesamten Körpers. Die Heilwirkung führte Kneipp einerseits darauf zurück, dass Krankheitserreger durch das Wasser aus dem Körper gelöst und beseitigt würden. Andererseits würde der Körper durch die kalten Anwendungen gegen Kälte abgehärtet und so im Allgemeinen widerstandsfähiger. Wissenschaftlich ist heute erwiesen, dass gerade die kalten und wechselwarmen Anwendungen durchblutungsfördernd und gefäßtrainierend wirken was in der Tat zu einer Abhärtung des Körpers gegenüber Kälte führt. Besonders für schlecht durchblutete Extremitäten ist eine Kneippsche Wasserbehandlung daher äußerst förderlich.
Bereits zu Kneipps Zeiten war ebenfalls die Anregung des Immunsystems durch kalte Wasseranwendungen bekannt und der damit verbundene Schutz vor Infektionskrankheiten. Auch bei Patienten mit Neurodermitis oder anderen Störungen des Immunsystems wird die Kneipp Wassertherapie wirksam angewandt. Darüber hinaus bewirken regelmäßige, mehrwöchige kalte Wasseranwendungen eine deutliche Verringerung von Stress. Durch den Kalt reiz werden Stresshormone (Adrenalin) im Körper ausgeschüttet, deren Konzentration mit der Häufigkeit der Anwendung deutlich sinkt. Der menschliche Organismus gewöhnt sich an den Stressreiz Kälte, was nach und nach auch auf andere Stressfaktoren, insbesondere psychischen Stress, übertragen wird. Äußere Reize werden immer weniger zu Stressfaktoren für den Menschen, was nicht zuletzt eine wirkungsvolle Vorbeugung vor Krankheiten bedeutet, da viele körperliche Beschwerden durch Stress ausgelöst werden.
Warmwasseranwendungen stärken dagegen den Stoffwechsel und tragen zur Muskelentspannung nach Sport und Stress sowie zur Linderung rheumatischer Erkrankungen bei.
Die Behandlung erfolgt bei Kaltwasseranwendungen streng nach dem Prinzip warm - kalt - warm: das heißt nicht, dass von warmem zu kaltem und wieder zu warmem Wasser gewechselt wird, sondern dass die Behandlung nur bei warmem Körper erfolgen darf und dieser nachher unbedingt wieder aufgewärmt werden muss. Dazu wird der Körper nicht abgetrocknet (das Wasser wird nur mit den Händen abgestreift), sondern in ein Tuch oder die Kleidung gehüllt und entweder durch Bettwärme oder besser durch Bewegung aufgewärmt. Die Therapie wird ganz auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt und erfolgt vor allem in Form von Güssen, Waschungen, Bädern und Wickeln des ganzen Körpers oder einzelner Körperpartien.
_________________________
Güsse
Kneipp selbst favorisierte unter allen Wasseranwendungen die Güsse. Das Besondere an seiner
Methode ist ein im Durchmesser etwa zwei Zentimeter großer gebundener, fast druckloser Wasserstrahl. Die Wassertemperatur beträgt beim kalten Guss zwischen 10 ° C und 15 ° C, beim warmen etwa 36 ° C bis 38 ° C. In einem Abstand von 10 bis 15 Zentimetern zum Körper wird ein kalter Guss ungefähr 30 Sekunden angewandt. Beim wechselwarmen Guss sollte mit einem Warmwasserguss von ca. 2 Minuten begonnen werden, auf den ein Kaltwasserguss von ca. 20 Sekunden folgt. In stetig abnehmendem Zeittakt werden die Güsse gewechselt, wobei immer mit einem kalten abgeschlossen wird. Man unterscheidet zwischen Knie -, Schenkel -, Brust -, Arm - und Vollgüssen.
Anwendungsbeispiel
Wechselfußbad
Es kurbelt die Durchblutung an, kräftigt das Immunsystem und entspannt vor dem Einschlafen.
- In eine Fußbadewanne oder einen Eimer warmes Wasser (37-39 °C) bis eine Hand breit unter den Knien einlassen, eine zweite Wanne auf gleicher Höhe mit kaltem Leitungswasser füllen.
- Im Warmwasserbad die Füße 3-5 Minuten baden.
- Dann die Füße kurz in das Kaltwasserbad tauchen und zurück ins Warmwasserbad wechseln.
- Das Wechselbad im Kaltwasserbad beenden, das Wasser nur mit den Händen abstreifen und die Füße in dicken Socken und Decken unbedingt erwärmen.
Waschungen
Waschungen erfolgen als Oberkörper-, Unterkör-per-, Leib- oder Ganzwaschung mit einem groben, in 12-16 °C kaltem Wasser getränkten Leintuch, morgens nach dem Aufstehen. Bei bettlägerigen Patienten spielt sie sich im Bett ab. Das Tuch wird in das Wasser getaucht und so fest ausgewrungen, dass es nicht mehr tropft. Damit der Körper nicht auskühlen kann, sollte die Waschung rasch erfolgen. Der Körper wird nicht abgetrocknet, sondern im Bett oder durch Bewegung erwärmt.
Bäder
Die Palette der Kneippschen Bäder ist groß: Sie reicht von Vollbädern über Dreiviertel-, Halb- Sitzbäder bis zu Fuß- und Armbädern. Außerdem gibt es warme (36-39 °C), temperierte (16-22 °C) und kalte (10-15 °C) Bäder, temperaturansteigende Bäder und Wechselbäder mit Hilfe von zwei Wannen. Warmbäder werden häufig mit Heilpflanzenzusätzen versehen und mit kalten Güssen abgeschlossen. Sie bewirken die Schließung der Körperporen und schützen vor einer Erkältung. Die Badedauer wird nach der Art des Bades bemessen.
Wickel
Kneippsche Wickel können mit und ohne Zusätze von Lehm, Quark, Heublumen oder Essig, kalt, warm oder heiß, am ganzen Körper oder an einzelnen Körperteilen durchgeführt werden. Am bekanntesten sind wohl die zur Fiebersenkung gedachten kalten Wadenwickel. Jeder Wickel besteht aus einem Innentuch aus Leinen, einem Zwischentuch aus Leinen und einer äußeren Hülle aus Wolle. Entfernt wird der Wickel, wenn er warm ist oder trocken. Gewickelt wird am besten im Bett liegend, nach der Behandlung ist eine halbstündige Bettruhe angezeigt.
Neben diesen Methoden eignen sich zur spontanen Anwendung auch die weitläufig bekannten Verfahren des Wassertretens, Tautretens und Schneegehens. Hierbei muss jedoch bedacht wer-den, dass die Beine warm sind und durch kräftiges Gehen nach der Anwendung wieder erwärmt werden müssen. Außerdem sollen insbesondere das Tautreten und Schneegehen bei Nierenerkrankungen oder Erkrankungen der Geschlechtsorgane nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.
Weiterführende Themengebiete
- Was ist Naturheilkunde?
- Übersicht Naturheilverfahren
- Aura soma
- Aderlass
- Akupunktur
- Anthrosophische Medizin
- Aromatherapie / Ätherische Öle
- Ausleitungsverfahren
- Balneotherapie
- Bach - Blüten
- Die 38 Bach Blüten
- Bindegewebsmassage
- Blutegeltherapie
- Edelsteintherapie
- Eigenbluttherapie
- Heilsteine, Edelsteine & Kristalle
- Eigenbluttherapie
- Enzymtherapie
- Homöopathie
- Homöopathie Tiere
- Kneipp - Therapie
- Hydrotherapie
- Hypnose
- Phytotherapie
- Spagyrik
- Vorbeugen ist besser als heilen!